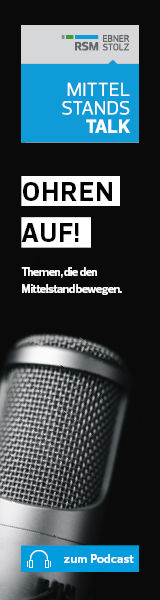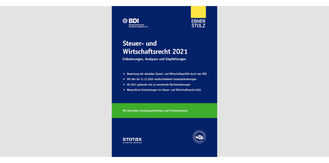Im Folgenden geben wir einen Überblick über alle gemeinnützigkeitsrelevanten Änderungen im JStG 2020 und beleuchten detailliert die Vorschriften mit den weitreichendsten Auswirkungen.
 © unsplash
© unsplashAnhebung der Freibeträge und Freigrenzen
- Übungsleiterfreibetrag
Nebenberufliche Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Organist, o. ä. können ab dem Veranlagungszeitraum 2021 in einem höheren Umfang steuerfrei vergütet werden. Der jährliche Freibetrag wurde von 2.400 Euro auf 3.000 Euro erhöht, § 3 Nr. 26 EStG. - Ehrenamtsfreibetrag
Analog wurde auch die Ehrenamtspauschschale angehoben, welche für nebenberufliche Einnahmen greift, die nicht unter die Übungsleiterpauschale fallen (z. B. Kassierer eines Vereins). Ab 1.1.2021 können im Jahr 840 Euro, statt bislang 720 Euro, steuerfrei vergütet werden, § 3 Nr. 26a EStG.
Hinweis: Bislang hat der Gesetzgeber versäumt, die korrespondierenden Vergütungsgrenzen beim Haftungsprivileg nach §§ 31a, 31b BGB ebenfalls anzuheben. Es ist aber davon auszugehen, dass dies noch vorgenommen wird, sodass ehrenamtlich tätige Vorstände oder Vereinsmitglieder 840 Euro erhalten können und dann für einen bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verursachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften. - Erhöhung der Grenze für den vereinfachten Zuwendungsnachweis
Die Grenze, bis zu welcher der vereinfachte Zuwendungsnachweis für den Spendenabzug ausreicht, wurde erhöht. Nach § 50 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStDV genügt der Bareinzahlungsbeleg, Überweisungsträger oder die Buchungsbestätigung aus dem Online-Banking bei einer Spende bis 300 Euro (bislang 200 Euro). Diese Änderung gilt bereits rückwirkend für Zuwendungen, die der Empfängerkörperschaft nach dem 31.12.2019 zugeflossen sind.
Freigrenze in § 64 Abs. 3 AO
Die Freigrenze, bis zu der eine gemeinnützige Körperschaft Einnahmen (einschließlich Umsatzsteuer) im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs, der kein Zweckbetrieb ist, erzielen darf, wurde von 35.000 Euro auf 45.000 Euro erhöht. Die als Vereinfachungsregelung eingeführte Freigrenze dient dazu, dass neben einer ideellen Tätigkeit geringfügige Umsätze mit wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben erzielt werden dürfen.
Hinweis: Bei dieser Vorschrift handelt es sich um eine Freigrenze und nicht um einen Freibetrag. Das bedeutet, dass eine Körperschaft, deren Bruttoeinnahmen 45.000 Euro übersteigen, den gesamten Gewinn aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben der Körperschaft- und Gewerbesteuer zu unterwerfen hat.
Diese Änderung gilt bereits ab dem Tag nach der Verkündung des Gesetzes, sodass die Grenze bereits für das Veranlagungsjahr 2020 angehoben wurde und in der Steuererklärung 2020 Anwendung findet.
Neue gemeinnützige Zwecke
Der gesetzliche Katalog gemeinnütziger Zwecke nach § 52 Abs. 2 AO wurde wie folgt erweitert:
- Förderung des Klimaschutzes
- Förderung der Hilfe für Menschen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer geschlechtlichen Orientierung diskriminiert werden
- Förderung der Ortsverschönerung
- Förderung der Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen sowie Förderung der Unterhaltung von Gedenkstätten für nichtbestattungspflichtige Kinder und Föten.
Hinweis: Bereits bestehende gemeinnützige Körperschaften, die diese Zwecke verfolgen möchten, müssen ihre Satzung ändern und diese Zwecke ergänzen. Zu beachten sind dabei stets die oftmals engen Möglichkeiten in der Satzung für Zweckänderungen. Stiftungen des privaten Rechts könnten zudem vor der Herausforderung stehen, dass in der Praxis die Stiftungsaufsichtsbehörden bei Zweckerweiterungen oftmals einen Nachschuss zum Stiftungsvermögen fordern.
Ergänzung Katalogzweckbetriebe
Durch das JStG 2020 wurden zudem die Katalogzweckbetriebe um zwei weitere Zweckbetriebe ergänzt. Im Gegensatz zur früheren Rechtslage sind Einrichtungen zur Versorgung, Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen nun nicht mehr als Zweckbetrieb i. S. d. § 66 AO, sondern unter einen Katalogzweckbetrieb zu subsumieren. § 68 Nr. 1 c) AO sieht aber weiterhin vor, dass die Voraussetzungen von § 66 Abs. 2 zu berücksichtigen sind, d. h. der Zweckbetrieb darf „nicht des Erwerbs wegens“ ausgeübt werden. Erfreulich ist dennoch, dass die Körperschaften nun nicht mehr die bürokratischen Nachweise über die Leistungen an Flüchtlinge als begünstigter Personenkreis nach § 53 AO vorlegen müssen.
Des Weiteren ist als Zweckbetrieb die entgeltliche Durchführung der Fürsorge für psychische und seelische Erkrankungen bzw. Behinderungen anzusehen.
Aufgabe der Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung für kleinere Körperschaften
Körperschaften mit Einnahmen von höchstens 45.000 Euro pro Jahr sind vom Gebot der zeitnahen Mittelverwendung befreit, § 55 Abs. 1 Nr. 5 Satz 4 AO. Für die Ermittlung der Einnahmen sind die Einnahmen des ideellen Bereichs, des Zweckbetriebs, Vermögensverwaltung und steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe zu kumulieren.
Grund für die Einführung der Vorschrift ist der Abbau der Bürokratie, weil die Finanzämter die Mittelverwendung nicht mehr überprüfen müssen. Stiftungen, die nur geringe Einnahmen erzielen, stehen derzeit im Zwiespalt, da stiftungsrechtlich die Erträge des Stiftungsvermögens ausschließlich für die Stiftungszwecke einzusetzen sind und nicht langfristig angesammelt werden dürfen. Bei Stiftungen könnte es somit zu einem Konflikt zwischen dem Gemeinnützigkeits- und dem Stiftungsrecht kommen. Bislang haben sich die Stiftungsaufsichtsbehörden noch nicht dazu geäußert.
Für die Praxis bedeutet das, dass die „kleinen Körperschaften“ die Mittelverwendung gegenüber der Finanzverwaltung nicht nachweisen müssen und somit keine zweckgebundenen Rücklagen zu bilden wären. Die freie Rücklage sollte aber trotzdem, sofern möglich, in höchstmöglichem Umfang gebildet werden, da die Mittel als nicht gebundenes Vermögen flexibel eingesetzt werden können. Die Vorschrift erleichtert somit lediglich die zeitliche Dimension der Mittelverwendung.
Fraglich ist derzeit noch, ob tatsächlich alle Einnahmen der Körperschaft zu kumulieren sind, da dann ggfs. auch Einnahmen darunter zu fassen sind, die vom Grundsatz gar nicht zeitnah zu verwenden sind. Das sind z. B. Einnahmen, die zum Vermögen nach § 62 Abs. 3 AO zählen (u. a. Erbschaften, Einnahmen auf Grund eines Spendenaufrufs). Hier bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwaltung im Anwendungserlass zur Abgabenordnung noch Eingrenzungen vorsieht.
Hinweis: Zu empfehlen ist, die neue Vorschrift nur für Körperschaften anzuwenden, deren Einnahmen nicht an der Grenze schwanken, sondern stets Einnahmen unter 45.000 Euro erzielen und damit die Grenze in allen Jahren einhält.
Neuregelung der Mittelbeschaffung und -weitergabe
Die Weitergabe von Mitteln an eine andere Körperschaft oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke wird künftig nur noch in einem einheitlichen Tatbestand in § 58 Nr. 1 AO geregelt. Die Mittelweiterleitung nach § 58 Nr. 2 AO wurde aufgehoben, sodass die nur „teilweise“ Möglichkeit wegfällt.
Gesetzlich verankert ist nun, was unter den Mittelbegriff fällt. „Mittel“ sind danach nicht nur Bar- oder Buchgeld, sondern auch alle anderen Vermögenswerte (unentgeltliche oder verbilligte Nutzungsüberlassung oder unentgeltliche oder verbilligte Erbringung einer Dienstleistung). Wendet eine Körperschaft Mittel einer beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaft des privaten Rechts zu, bestimmt das Gesetz, dass diese selbst steuerbegünstigt sein muss.
Bei der Mittelweitergabe handelt es sich ausdrücklich um eine Art der Zweckverwirklichung und nicht um einen eigenständigen Zweck. Das Gebot der Satzungsklarheit verlangt, dass eine Tätigkeit satzungsgemäß verankert sein muss, wenn es sich um das einzige Mittel zur Verwirklichung des geförderten Zwecks handelt (bei reinen Förderkörperschaften).
Die neue Regelung verlangt ausdrücklich nicht, dass die Empfängerkörperschaft die erhaltenen Mittel nur für die Satzungszwecke der Geberkörperschaft verwenden darf. Die bislang in § 58 Nr. 1 AO notwendige teilweise Zweckidentität fällt nun weg. Die Neuregelung führt allerdings dazu, dass die Verwendung der Mittel für Satzungszwecke ins Zivilrecht verlagert wird. Aus vereins-, stiftungs- und spendenrechtlichen Gründen hat die zuwendende Körperschaft dennoch darauf zu achten, dass die Mittelweiterleitung satzungskonform ist. Ansonsten kann eine nicht zweckentsprechende Verwendung Rückforderungsansprüche von Spendern oder Mitgliedern auslösen. Die Finanzverwaltung erleichtert sich allerdings mit dieser neuen Regelung eine Überprüfung der Gemeinnützigkeit aufgrund des Wegfalls der Zweckidentität. Sie muss lediglich überprüfen, ob die Mittel an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft geflossen sind.
Ausländische (im EU/EWR-Mitgliedsstaat ansässige) Körperschaften, die in Deutschland inländische Einkünfte erzielen und damit der beschränkten Steuerplicht unterliegen, dürfen nur noch gefördert werden, wenn diese in Deutschland als gemeinnützig anerkannt sind und somit sämtliche Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit erfüllen. Erzielen ausländische Körperschaften keine inländischen Einkünfte, dürfen diese wie bisher, unter Beachtung der erhöhten Nachweispflichten gefördert werden.
Hinweis: Bei Förderungen ins Ausland ist bei der Empfängerkörperschaft daher künftig abzufragen, ob diese inländischen Einkünfte erzielt und somit als beschränkt steuerpflichtig gilt.
Neu eingefügt wurde der Vertrauensschutz nach § 58a AO. Nach bisherigem Recht war nicht geregelt, ob und unter welchen Voraussetzungen eine steuerbegünstigte Körperschaft schutzwürdig ist, die Mittel an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft weiterleitet.
Steuerbegünstigte Körperschaften dürfen ihre Mittel grundsätzlich nur dann anderen steuerbegünstigten Körperschaften überlassen, wenn der Empfänger der Mittel damit steuerbegünstigte Zwecke verwirklicht. Entfällt die Steuerbegünstigung des Empfängers der Mittel oder verwendet dieser die Mittel nicht für steuerbegünstigte Zwecke, verstößt die gebende Körperschaft an sich gegen Regelungen des Gemeinnützigkeitsrechts.
Die zuwendende Körperschaft kann künftig darauf vertrauen, dass die empfangende Körperschaft im Zeitpunkt der Zuwendung steuerbegünstigt ist und die zugewendeten Mittel für steuerbegünstigte Zwecke verwendet, wenn ihr eine Ausfertigung des zu diesem Zeitpunkt gültigen Bescheids über die Gemeinnützigkeit der Körperschaft vorliegt. Somit müssten die Zuwender im Rahmen der Mittelweiterleitung einen Freistellungsbescheid oder die Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid - jeweils nicht älter als fünf Jahre - einfordern. Im Falle der Neugründung von gemeinnützigen Körperschaften reicht auch die Vorlage des Feststellungsbescheids nach § 60a AO aus, wenn die Ausstellung nicht länger als drei Jahre zurückliegt. Durch diese Ergänzung werden die Körperschaften berücksichtigt, welche im Zeitpunkt der Zuwendung noch nicht das erste Mal zur Körperschafsteuer veranlagt wurden.
Vertrauensschutz besteht nach der neuen Vorschrift dann nicht, wenn der zuwendenden Körperschaft die Unrichtigkeit eines Verwaltungsakts bekannt oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war oder die zuwendende Körperschaft eine Verwendung für nicht steuerbegünstigte Zwecke durch die empfangende Körperschaft veranlasst hat.
Auf Zuwendungen an juristische Personen des öffentlichen Rechts ist die Vorschrift nicht anwendbar. Begründet wird dies damit, dass die Verwaltung nach Art. 20 Abs 3 des Grundgesetzes an Gesetz und Recht gebunden ist und der Zuwender darauf vertrauen darf, dass eine juristische Person des öffentlichen Rechts die Mittel nicht entgegen einer Zweckbestimmung für nicht steuerbegünstigte Zwecke verwendet.
Hinweis: Die bislang übliche Praxis, dass die Empfängerkörperschaft der zuwendenden Körperschaft eine Zuwendungsbestätigung ausstellt, führt nicht zum Vertrauensschutz im Sinne des § 58a AO. Wir empfehlen daher, künftig anstatt einer Zuwendungsbestätigung die Vorlage des aktuellsten Freistellungsbescheids oder der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid zu verlangen.
Möglichkeit der Aufhebung von Feststellungsbescheiden nach § 60a AO
Die Finanzverwaltung behält sich künftig vor, bei Verstößen gegen die tatsächliche Geschäftsführung zwischen Erlass des Feststellungsbescheids und der ersten Veranlagung zur Körperschaftsteuer den Feststellungsbescheid nach § 60a AO wieder aufzuheben. Ziel der neuen Regelung ist, die rechtsmissbräuchliche Verwendung des Feststellungsbescheids nach § 60a AO auszuschließen. Damit kann in Missbrauchsfällen der Rechtsschein der Gemeinnützigkeit beseitigt bzw. das Entstehen eines Rechtsscheins verhindert werden. Dies erhöht auch das Vertrauen des Spenders auf die korrekte Verwendung der von ihm zugewendeten Spende.
Hinweis: Wir gehen davon aus, dass die Neuregelung nur in seltenen Fällen zur Anwendung kommen wird und sehen hier keine Bedrohung für Körperschaften, deren Tätigkeiten aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden sind.
Zuwendungsempfängerregister nach § 60b AO
Ab 1.1.2024 soll vom Bundeszentralamt für Steuern ein Zuwendungsempfängerregister geführt werden. Die Speicherung der Daten erfolgt zum Zweck des Sonderausgabenabzugs nach § 10b EstG und soll zum Abgleich bei den digitalen Zuwendungsbestätigungen dienen. Die im Zuwendungsempfängerregister gespeicherten Daten liefert das Finanzamt im Rahmen der Veranlagung. Nähere Informationen hierzu werden wir zu gegebener Zeit veröffentlichen.
Weitere Änderungen im Jahressteuergesetz 2020
- Umsatzsteuerliche Änderungen im Gesundheitsbereich
Die Änderungen im Umsatzsteuergesetz in § 4 Nr. 14 und 16 UStG sind insb. für den Gesundheitsbereich von Relevanz. Für die Details der relevanten Regelungen verweisen wir auf den novus Gesundheitswesen 3. Ausgabe 2020. - Umsatzsteuerfreiheit von Verpflegungsdienstleistungen
Verpflegungsdienstleistungen nach § 4 Nr. 23 c) UStG können mit Wirkung ab dem 1.1.2020 steuerfrei sein, wenn die Leistungen an Studierende und Schüler erbracht werden. Als Studierende und Schüler gelten alle an Hochschulen im Sinne der Hochschulgesetze der Länder, an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie, an öffentlichen Schulen und an Ersatzschulen, die gemäß Art. 7 Abs. 4 des Grundgesetzes staatliche genehmigt oder nach Landesrecht erlaubt sind, sowie an staatlich anerkannten Ergänzungsschulen durch Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder durch andere Einrichtungen, die keine systematische Gewinnerzielung anstreben, eingeschriebenen natürlichen Personen. Mit dem JStG 2020 sind nach § 4 Nr. 23 c) UStG auch kurzfristige Beherbergungsleistungen (und nicht nur Verpflegungsleistungen) gegenüber Studierenden und Schüler steuerfrei. Ebenfalls steuerfrei sind die Beköstigungs- und/oder Beherbergungsleistungen an die „Bediensteten“, die mit dem Unterricht verbunden sind. Hiermit sind z. B. die betreuenden Lehrer gemeint. - Einführung einer Homeoffice-Pauschale
Liegt kein häusliches Arbeitszimmer vor oder wird auf einen Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer verzichtet, kann der Steuerpflichtige nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 4 EStG für jeden Kalendertag, an dem er seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen Wohnung ausübt und keine außerhalb der häuslichen Wohnung belegene Betätigungsstätte aufsucht, für seine gesamte betriebliche und berufliche Betätigung einen Betrag von 5 Euro abziehen, höchstens 600 Euro im Wirtschafts- oder Kalenderjahr. Die Homeoffice-Pauschale wird in die Werbungskostenpauschale eingerechnet und nicht zusätzlich gewährt. - Verlängerung für Corona-Sonderzahlungen
Die Steuerbefreiung für aufgrund der Corona-Krise an Arbeitnehmer gezahlten Beihilfen und Unterstützungen bis zur Höhe von 1.500 Euro nach § 3 Nr. 11a EStG war ursprünglich bis zum 31.12.2020 befristet. Die Frist wurde durch das JStG 2020 bis Juni 2021 verlängert. Die Fristverlängerung führt aber nicht dazu, dass eine Corona-Beihilfe im ersten Halbjahr 2021 nochmals in Höhe von 1.500 Euro steuerfrei bezahlt werden kann. - Anhebung der Freigrenze für Sachbezüge
Die monatliche Freigrenze für Sachbezüge in § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG wird ab 1.1.2022 von 44 Euro auf 50 Euro angehoben.