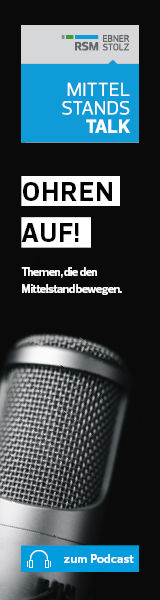Minderjährige sind von der Mindestlohnverpflichtung ausgenommen, sofern sie noch keine abgeschlossene Berufsausbildung aufweisen; für das Ehrenamt gelten Erleichterungen. Auch Auszubildende müssen keinen Mindestlohn erhalten. Anspruch auf den Mindestlohn haben im Übrigen aber nicht nur Mitarbeiter in regelmäßigen Voll- und Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen, sondern auch Aushilfen, geringfügig Beschäftigte, Saisonkräfte und - von Ausnahmen abgesehen - Praktikanten. Deshalb sind nicht nur bestimmte Branchen vom gesetzlichen Mindestlohn betroffen, sondern nahezu jedes Unternehmen.
 © Thinkstock
© ThinkstockDabei verlangt der Gesetzgeber von den Arbeitgebern nicht nur, den Mindestlohn zu zahlen. Vielmehr stellt er eine ganze Reihe weiterer Vorgaben auf, so etwa zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Lohnzahlung. Diese hat nämlich laut Mindestlohngesetz spätestens am letzten Bankarbeitstag des auf die Arbeitsleistung folgenden Monats zu erfolgen. Arbeitsvertragliche Vereinbarungen über frühere Zahlungstermine haben selbstverständlich Vorrang.
Lediglich ordnungsgemäß und schriftlich vereinbarte Arbeitszeitkonten genießen insoweit einen gewissen Schutz. Diese bleiben zulässig, so dass die Vergütung von Mehrarbeit durch entsprechende Verbuchung in gewissem Rahmen aufgeschoben werden kann.
Aber nicht nur deshalb stellt sich die Eigenkontrolle des Arbeitgebers als aufwändig heraus. Sieht etwa der Arbeitsvertrag einen festen Grundlohn von weniger als 8,50 Euro pro Stunde vor, ist im Einzelfall zu prüfen, ob der Mindestlohn nicht doch noch durch Hinzurechnung weiterer Lohnbestandteile erreicht wird.
Bisweilen noch komplexer zu beurteilen sind Pauschallohnvereinbarungen, etwa in Form eines festen Monatsgehalts. Liegt die monatliche Grundvergütung nicht eindeutig über dem Mindestlohn, so ist insbesondere im Falle variablen Arbeitsabrufs Sorgfalt geboten. In vielen Fällen wird sich eine Schattenrechnung auf Mindeststundenlohnbasis nicht vermeiden lassen, mit entsprechendem administrativem Mehraufwand. Das betrifft vor allem Aushilfen, aber auch Mitarbeiter mit relativ niedriger Grundvergütung und häufigen Überstunden.
Vor diesem Hintergrund ist die derzeitige Diskussion um die Mindestlohnaufzeichnungspflichten zu sehen. So sind in bestimmten Branchen für alle Arbeitnehmer, die ein Monatsgehalt von bis zu 2.958 Euro beziehen, Aufzeichnungen über die tatsächlich geleistete Arbeit zu führen. Betroffen sind u. a. das Baugewerbe, das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe sowie das Speditions- und damit verbundene Logistikgewerbe.
Flächendeckend und für alle Arbeitgeber gelten die Aufzeichnungspflichten jedoch hinsichtlich ihrer geringfügig oder kurzfristig Beschäftigten. In allen genannten Fällen sind innerhalb einer Woche nach der Arbeitsleistung der Beginn, das Ende und die Dauer der täglichen Arbeitszeit aufzuzeichnen und für mindestens zwei Jahre aufzubewahren.
Ohnehin besteht bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen Anlass zu besonderer Obacht. Nicht selten ist hier etwa eine Arbeitszeit von 15 Wochenstunden vereinbart. Das führt zu 60 bis 65 Arbeitsstunden je Monat; multipliziert mit dem Mindestlohn wären dafür 510 Euro bis 552,50 Euro brutto zu zahlen, also mehr als die Geringfügigkeitsgrenze, die bei 450 Euro liegt. Fordert der Mitarbeiter den Mindestlohn ein, ist nicht nur die Lohndifferenz nachzuzahlen, sondern verliert das Arbeitsverhältnis rückwirkend seine Einstufung als geringfügig. Es kommt zu steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Nachzahlungen, die zum größten Teil den Arbeitgeber treffen.
Unter Beachtung der Geringfügigkeitsgrenze darf ein geringfügig beschäftigter Mitarbeiter derzeit somit nicht mehr als rund 52,9 Stunden je Monat arbeiten. Bestehende Arbeitsverträge mit geringfügig Beschäftigten sollten deshalb auf die Regelung zur Arbeitszeit, inklusive einer etwaigen Überstundenregelung, überprüft werden.
Schließlich ist auch das Ausweichen auf das Outsourcing einzelner Leistungen durch Unterauftragsverhältnisse nicht unproblematisch. So kann nämlich der Auftraggeber vom Mitarbeiter seines Subauftragnehmers auf Zahlung des Mindestlohns in Anspruch genommen werden, wenn der Subauftragnehmer dieser Verpflichtung selbst nicht nachkommt. Zwar besitzt der auf diese Weise in die Haftung genommene Auftraggeber einen Regressanspruch gegenüber seinem Subauftragnehmer, doch sind teure Rechtsstreitigkeiten vorprogrammiert und läuft der Anspruch bei Insolvenz des Subauftragnehmers ins Leere.
Letztlich bleibt festzuhalten: Jedes Unternehmen - und übrigens auch jeder Verein und jede Privatperson, sofern sie Arbeitnehmer beschäftigen - hat die Einhaltung der Mindestlohnregelungen zu prüfen. Verstöße führen nicht nur zu Nachzahlungspflichten, sondern stellen in vielen Fällen auch Ordnungswidrigkeiten mit erheblichen Bußgeldandrohungen dar. Zudem droht der Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge. Das gilt es zu vermeiden.