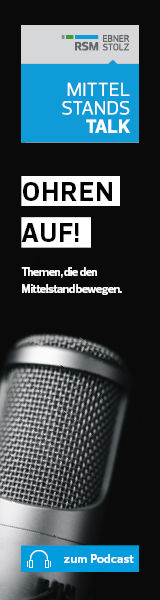Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung eines Arbeitszimmers
Durch die Arbeit im Home-Office entfällt zwar der sonst tägliche Arbeitsweg und die damit einhergehenden Kosten. Es entstehen jedoch Aufwendungen im Rahmen des Wohneigentums, inklusive Instandhaltungskosten, bzw. anteilige Wohnungsmiete auf das (neu eingerichtete) Home-Office oder höhere Wasser-, Heiz- und Stromkosten durch die Tätigkeit von zu Hause aus.
Ob die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen zum Werbungskostenabzug zugelassen sind, hängt insb. davon ab, ob es sich beim Home-Office auch um ein häusliches Arbeitszimmer im steuerlichen Sinn handelt. Dies ist nur dann anzunehmen, wenn ein separates, räumlich abgeschlossenes Zimmer vorliegt. Davon abzugrenzen sind Arbeitsecken in sonst ausschließlich privat genutzten Räumen, wie bspw. die Nutzung des Ess- oder Wohnzimmertischs als Arbeitsplatz oder Wohnräume, die provisorisch mithilfe eines Raumtrenners geteilt werden.
Sofern ein baulich abgetrennter Raum vorhanden ist, muss darüber hinaus eine überwiegend berufliche Nutzung sichergestellt werden. Hiervon soll laut Rechtsprechung nur ausgegangen werden, sofern die berufliche Nutzung mindestens 90 % beträgt.
Allein das Vorhandensein von privaten Gegenständen, seien es Sportgeräte, Fernseher oder private Literatur, soll für die Qualifizierung eines steuerrechtlichen Arbeitszimmers bereits schädlich sein und den Werbungskostenabzug bei einer privaten Nutzung von mehr als 10 % vollständig verwehren. In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich, den Nachweis eines häuslichen Arbeitszimmers anhand von Fotos zu dokumentieren und eventuelle Belege aufzubewahren.
Als zweite Voraussetzung gilt, dass dem Arbeitnehmer kein anderer Arbeitsplatz mehr zur Verfügung steht. Hierbei ist unerheblich, dass theoretisch ein Arbeitsplatz während der Pandemie im Betrieb des Arbeitgebers vorhanden ist. Entscheidend ist vielmehr, ob der Arbeitnehmer diesen auch tatsächlich nutzen kann. Dies ist bspw. dann nicht gegeben, wenn der Arbeitgeber aus Infektionsschutzgründen das Arbeiten im Büro untersagt und stattdessen das Arbeiten im Home-Office anordnet. Für den Nachweis stellt sich eine Bescheinigung des Arbeitgebers als durchaus sinnvoll dar, aus der hervorgeht, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt oder einen bestimmtem Zeitraum der ursprüngliche Arbeitsplatz aufgrund der Corona-Krise nicht nutzbar ist bzw. war.
Hinweis: Sollte sich der Arbeitnehmer aus Gründen der Prävention dazu entscheiden, seinen vorhandenen Arbeitsplatz nicht mehr zu nutzen, ohne vom Arbeitgeber explizit dazu angewiesen worden zu sein, sollte diese Voraussetzung ebenfalls als erfüllt gelten, da lediglich den Empfehlungen der Politik, Behörden und Medizinern nachgekommen wird. Die Finanzverwaltung hat sich hierzu jedoch nicht geäußert.
Steht dem Arbeitnehmer kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, kann er die Aufwendungen des häuslichen Arbeitszimmers bis zu einem Betrag von 1.250 Euro als Werbungskosten im Rahmen seiner persönlichen Einkommensteuererklärung geltend machen. Dabei ist der Höchstbetrag von 1.250 Euro pro Jahr auch bei nicht ganzjähriger Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers in voller Höhe, also nicht zeitanteilig, zum Abzug zuzulassen.
Der Werbungskostenabzug ist darüber hinaus sogar ohne betragliche Begrenzung möglich, wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit darstellt. Vereinfachend kann dieser Fall angenommen werden, wenn kein anderer Arbeitsplatz mehr zur Verfügung steht und der Arbeitnehmer seine gesamte Tätigkeit im Home-Office erbringt.
(Teilweiser) Ersatz der Aufwendungen für das Home-Office durch den Arbeitgeber
Ersetzt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Kosten für das Arbeitszimmer in der eigenen oder gemieteten Wohnung, liegt grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn vor, weil es für diesen Werbungskostenersatz keine Steuerbefreiungsvorschrift gibt.
Überlässt aber der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für die berufliche Tätigkeit betriebliche Computer, Telekommunikationsgeräte usw., die im Eigentum des Arbeitgebers stehen, führt eine zudem private Nutzung nicht zu einem steuerpflichtigen geldwerten Vorteil (§ 3 Nr. 45 EStG). Übereignet der Arbeitgeber diese Arbeitsmittel dem Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt, greift diese Steuerbefreiung hingegen nicht.
Stehen die für die berufliche Tätigkeit eingesetzten Arbeitsmittel im Eigentum des Arbeitnehmers und zahlt der Arbeitgeber für die Nutzung bzw. deren Erwerb eine Vergütung, zählt diese Vergütung zum steuerpflichtigen Arbeitslohn.
Erstattet der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern im Rahmen des steuerfreien Auslagenersatzes gemäß § 3 Nr. 50 EStG Betriebskosten für die eingesetzten Arbeitsmittel, allen voran Strom- und Telekommunikationskosten, ist das steuerfrei. Auslagen des Arbeitnehmers in diesem Sinne sind von ihm getätigte Ausgaben, die ganz überwiegend im betrieblichen Interesse des Arbeitgebers erfolgen, der Arbeitsausführung dienen und beim Arbeitnehmer nicht als Werbungskosten berücksichtigt werden. Der steuerfreie Auslagenersatz ist grundsätzlich nur möglich, wenn die auf die berufliche Nutzung entfallenden Betriebskosten genau nachgewiesen werden.
Einführung einer Home-Office-Pauschale
Da wegen der Corona-Krise vermehrt vom Home-Office gearbeitet wird, wurde im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020 eine Home-Office-Pauschale eingeführt.
Erfüllt der häusliche Arbeitsplatz nicht die Voraussetzungen eines häuslichen Arbeitszimmers, kann eine Pauschale von 5 Euro für jeden Kalendertag, maximal 600 Euro im Wirtschafts- oder Kalenderjahr, abgezogen werden, an dem die betriebliche oder berufliche Tätigkeit ausschließlich von zu Hause aus ausgeübt wurde. Die Home-Office-Pauschale kann auch angesetzt werden, wenn der genutzte Raum zwar ein häusliches Arbeitszimmer im steuerlichen Sinne darstellt, der Steuerpflichtige aber auf den Abzug der tatsächlich angefallenen Kosten in dem gesetzlich vorgegebenen Rahmen nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG verzichtet.
Die Home-Office-Pauschale kann auch angesetzt werden, wenn der genutzte Raum zwar ein häusliches Arbeitszimmer im steuerlichen Sinne darstellt, der Steuerpflichtige aber auf den Abzug der tatsächlich angefallenen Kosten in dem gesetzlich vorgegebenen Rahmen nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG verzichtet.
Die Pauschale kann für eine nach dem 31.12.2019 und vor dem 1.1.2022 in der häuslichen Wohnung ausgeübte betriebliche oder berufliche Tätigkeit angesetzt werden.
Aus Vereinfachungsgründen sieht die Regelung keine Einschränkung für den Fall vor, dass bei gemeinsam Nutzungsberechtigten mehrere Personen eigene Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nach den Grundsätzen des häuslichen Arbeitszimmers bzw. die Home-Office-Pauschale geltend machen.
Hinweis: Bei Arbeitnehmern wirkt sich die Home-Office-Pauschale nur aus, soweit die in einem VZ angefallenen Werbungskosten insgesamt den Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1 000 Euro übersteigen.
In der Gesetzesbegründung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass parallel zum Ansatz der Home-Office-Pauschale für die entsprechenden Tage der Abzug der Entfernungspauschale für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte bzw. Betriebsstätte oder aber tagesgleich der Abzug tatsächlicher Fahrtkosten nicht in Betracht kommt.
Update:
- Gemäß dem am 02.02.2022 veröffentlichten Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) soll u. a. auch die Anwendung der Home-Office-Pauschale um ein Jahr, somit bis zum 31.12.2022, verlängert werden.
- Das BMF hat mit Schreiben vom 09.07.2021 Sonderregelungen für die Berücksichtigung eines Arbeitszimmers während der Corona-Pandemie getroffen. In dem Schreiben geht es zudem auf das Verhältnis des Werbungskostenabzugs für ein Arbeitszimmer und der Home-Office-Pauschale ein.