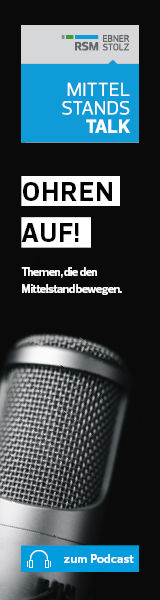Mit den Stimmen der Koalition von CDU/CSU und SPD wurden am 29.6.2017 im Bundestag neben dem Mieterstrom- und dem Netzentgeltmodernisierungsgesetz auch die Verordnungen für KWK- und Erneuerbare Energien-Ausschreibungen beschlossen. Zwischenzeitlich hat das Gesetzespaket am 7.7.2017 auch den Bundesrat passiert.
 © Thinkstock
© ThinkstockNetzentgeltmodernisierungsgesetz (NeMoG)
Steuerbare, dezentrale Einheiten speisen die erzeugte Energie überwiegend in das Niederspannungsnetz des lokalen Netzbetreibers ein. Der so eingespeiste Strom wird i.d.R. direkt durch den Netzbetreiber dieser Spannungsebene verwertet, wodurch er sich Kosten für die Netznutzung vorgelagerter Spannungsebenen erspart. Über § 18 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) muss der Netzbetreiber dem Betreiber der dezentralen Anlagen daher eine Vergütung für die für ihn vermiedenen Netznutzungskosten vorgelagerter Spannungsebenen leisten. Durch das NeMoG wird die Berechnungsgrundlage für diese sog. vermiedenen Netzentgelte (vNE) auf das Niveau des Jahres 2016 (ca. 0,5 bis 2 ct./kWh) gedeckelt.
Außerdem regelt das NeMoG, dass ab dem 1.1.2018 die Offshore-Anbindungskosten und die Erdkabel-Mehrkosten der Übertragungsnetzbetreiber aus der Berechnungsgrundlage für die vNE eliminiert werden und zum 1.1.2019 in die Offshore-Haftungsumlage überführt werden. Neuanlagen und Anlagen, die bis zum 31.12.2016 an die Höchstspannungsebene angeschlossen waren, sollen ab 2023 keine vNE mehr erstattet bekommen.
Lediglich für Bestandsanlagen ändert sich nichts.
Volatile Einspeiser, wie beispielsweise Windenergie- und PV-Anlagen, müssen ab 2018 ein beschleunigtes Abschmelzen über drei Jahre in Kauf nehmen, wobei Neuanlagen dann keine vNE mehr vergütet bekommen.
Hinweis
Ziel dieser Veränderungen bei den vNE ist eine stufenweise Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte ab dem Jahr 2019. Im Ergebnis müssen daher Letztverbraucher im Süden Deutschlands zugunsten von Letztverbrauchern im Norden mit steigenden Netzentgelten rechnen.
Abschließend sei auf eine Neuerung für Stromspeicher (z.B. Pumpspeicherkraftwerke) hingewiesen. Diese spielen zur Erreichung der mit der Energiewende verbundenen Zielsetzungen eine wichtige Rolle und sollen daher ab 2018 mit einer Entlastung bei den Netzentgelten gefördert werden. Hierzu werden die individuellen Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV mit den leistungsbezogenen Netzentgelten für Speicher nach § 19 Abs. 4 StromNEV kombiniert, so dass ein Absinken der Netzentgelte auf bis zu 20% des Leistungspreises möglich werden soll.
Hinweis
Zusammenfassend stellt das NeMoG zwar einerseits einen weitgehenden Bestandsschutz für Altanlagen sicher, führt aber bei anstehenden Entscheidungen über neue Projekte sicherlich dazu, dass hier nochmals neu gerechnet werden muss. Zudem bewirken die gesetzlichen Anpassungen, dass die Netzentgelte zu Lasten der Letztverbraucher im Süden Deutschlands neu kalkuliert werden müssen. Auch müssen energieintensive Unternehmen überlegen, ob sie eine Begrenzung betreffend die Offshore-Haftungsumlage in Anspruch nehmen können.
Mieterstromgesetz
Werden dezentrale Anlagen auf Mietwohngebäuden installiert, soll ab 2018 nach § 21 EEG 2017 ein Zuschlag zur Einspeisevergütung gezahlt werden. Dieser Zuschlag wird auch fällig, sofern solche Anlagen auf Gebäuden in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang (z. B. Quartierlösungen) installiert werden. Das Mieterstrommodell soll ergänzend zu den gesetzlichen Änderungen erstmals 2019 und danach jährlich umfassend evaluiert werden.
PV-Freiflächenanlagen mit Inbetriebnahme ab 1.7.2018 werden zukünftig nach § 24 Abs. 2 EEG 2017 zwingend zusammengefasst und die Anforderungen an Bürgerenergiegesellschaften werden ab 2018 dahingehend verschärft, dass diese an zukünftig obligatorischen Ausschreibungsverfahren nur dann teilnehmen können, wenn ihnen eine Genehmigung nach dem BImSchG vorliegt.
Die Bundesregierung verfolgt mit dem Mieterstromgesetz das Ziel, ab 2018 auch die Mieter an der Energiewende zu beteiligen. Hierzu sollen die Anlagenbetreiber den erzeugten Strom direkt an die Mieter des Hauses veräußern können. Zwar verzichten die Anlagenbetreiber dann auf die Einspeisevergütung, erhalten aber im Gegenzug einen Mieterstromzuschlag (zwischen 2,75 und 3,8 ct./kWh), und werden von den Netzentgelten, Konzessionsabgaben und weiteren Umlagen weitgehend entlastet. Im Ergebnis sollen sowohl die Mieter durch sinkende Mietnebenkosten als auch die Immobilienbesitzer durch eine höhere Attraktivität ihrer Immobilie und den Verkauf von Strom an die Mieter profitieren. Ob das Mieterstrommodell allerdings zu einem Erfolg wird, ist fraglich, da die Immobilienbesitzer sich dann mit gewerbesteuerlichen Folgen ebenso auseinandersetzen müssen wie mit den Folgewirkungen aufgrund sich ergebender Meldepflichten, bedingt durch die Veräußerung von Energie an sog. Letztverbraucher.
Mantelverordnung für KWK-Anlagen und innovative KWK-Systeme sowie Verordnungen zu den gemeinsamen Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen
Ebenfalls am 29.6.2017 hat der Bundestag eine Mantelverordnung für KWK-Ausschreibungen verabschiedet. Nach der Verordnung können sich erstmals am 1.12.2017 - und dann jeweils zu den Terminen 1.6. und 1.12. - bis 2021 KWK-Anlagen größer als 1 MW bis 50MW an den Ausschreibungen beteiligen. Für innovative KWK-Systeme (z. B. Kombination von erdgasbefeuerten KWK-Anlagen mit der Wärmebereitstellung aus Solarthermie) gilt eine Grenze von 10 MW. Das jährliche Ausschreibungsvolumen soll 150 MW nicht übersteigen. Investoren müssen aber beachten, dass die bei der Ausschreibung geforderte Sicherheitsleistung bis zu EUR 70 pro kW betragen kann.
Außerdem regelt die Mantelverordnung, dass die Anzahl der förderfähigen Vollbenutzungsstunden pro Jahr auf 3.500 begrenzt wird und dass die für die innovativen KWK-Systeme geforderten Komponenten zur Bereitstellung innovativer erneuerbarer Wärme (Power-to-Heat Module) nicht größer als 30 % der Wärmeleistung der KWK-Anlage dimensioniert sein müssen.